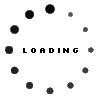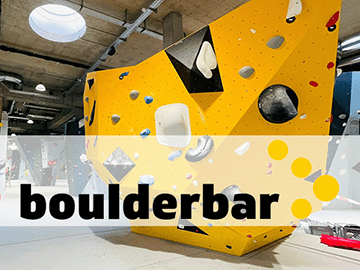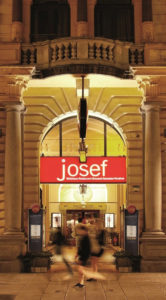Eingependelt hat sich der zu Jahresbeginn eingeführte Einwegpfand – auch wenn der größte Gewinner das System selbst ist: Bei einer Rücklaufquote von 80 % der etwa 2,2 Milliarden Flaschen und Dosen versickern durch den „Pfandschlupf“ jährlich fast 140 Millionen Euro, die nicht mehr ausbezahlt werden. Das entspricht einer jährlichen „Pfandsteuer“ von 60 Euro bei einer vierköpfigen Familie.
Das Geld geht an die de facto staatseigene GmbH „Recycling Pfand Österreich“, diese kümmert sich um alle Belange des Rückgabesystems. Die Firma bezeichnet sich als „gemeinnützig und nicht gewinnorientiert“. Im Firmenbuch steht diese als gemeinnützige GmbH, unter dem Strich eine Mischung aus klassischer Gesellschaft und gemeinnützigem Verein.
Eine Verwendung der enormen Summe – etwa für soziale Zwecke, für Projekte, die die Müllvermeidung fördern sollen oder auch als Rücklauf an die Konsumenten in welcher Form auch immer – ist laut Pfandverordnung nicht vorgesehen.
80 % der Einnahmen gehen an den Handel als eine Art Aufwandsentschädigung. Mit den Rest wird vor allem die erwähnte Recycling Pfand Österreich GmbH finanziert, die mit 24 Mitarbeitern in der Schönbrunner Schlossallee in Wien sitzt.
Kommentar
Schon klar, das heuer eingeführte Pfandsystem kostet Geld, viel Geld. Die Automaten, das Personal, die ganze Abwicklung und und und. Es ist aber schwer vorstellbar, dass die ganze Geschichte pro Jahr fast 140 Millionen Euro (das sind die Einnahmen aus dem Pfandschlupf) verbraucht und am Jahresende keine hohen Millionenbeträge übrig bleiben, die eigentlich in irgendeiner Form an die Konsumenten zurückfließen müssten.
Nutznießer des Systems sind auch die Supermarktketten, denn kaum jemand lässt sich den Pfandbon ausbezahlen, das Geld fließt viel mehr in den nächsten Einkauf. Da wäre es nur gerecht, wenn auch Spar, BILLA, Hofer & Co. die Kosten dieses Systems entscheidend mittragen.